Landwirtschaft und Kohlenstoffmärkte in Deutschland und Brasilien
Sowohl Brasilien als auch Deutschland haben sich verpflichtet, erhebliche Anstrengungen zu unternehmen, die Treibhausgase auch in der Landwirtschaft zu reduzieren, zuletzt in Glasgow mit der Vereinbarung zum Methanausstoß, besonders in der Rinderproduktion.
Land- und Forstwirtschaft ist im Gegensatz beispielsweise zur Stahl- und Zementindustrie ein Wirtschaftssektor, der den Ausstoß von Treibhausgasen nicht nur vermindern, sondern zusätzlich der Atmosphäre Kohlendioxid durch Einlagerung von Kohlenstoff im Boden entziehen kann.
Wir haben mit Fachleuten und Wissenschaftlern beider Länder darüber diskutiert, um was es genau geht und wie realistisch die Erwartungen sind.
Dieses Video ist im erweiterten Datenschutzmodus von YouTube eingebunden. Das Video wird somit auf dem Videoportal YouTube betrieben. Mit Klick auf den Wiedergabe-Button erteilen Sie Ihre Einwilligung darin, dass YouTube auf dem von Ihnen verwendeten Endgerät Cookies setzt, aber laut Angaben von YouTube keine Cookies zur Analyse Ihres Nutzungsverhaltens gesetzt werden. Näheres zur Cookie-Verwendung durch YouTube finden Sie in der Cookie-Policy von Google.

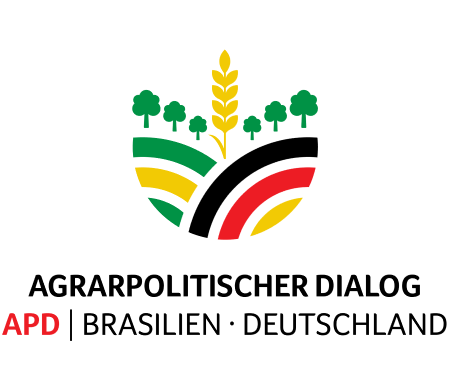






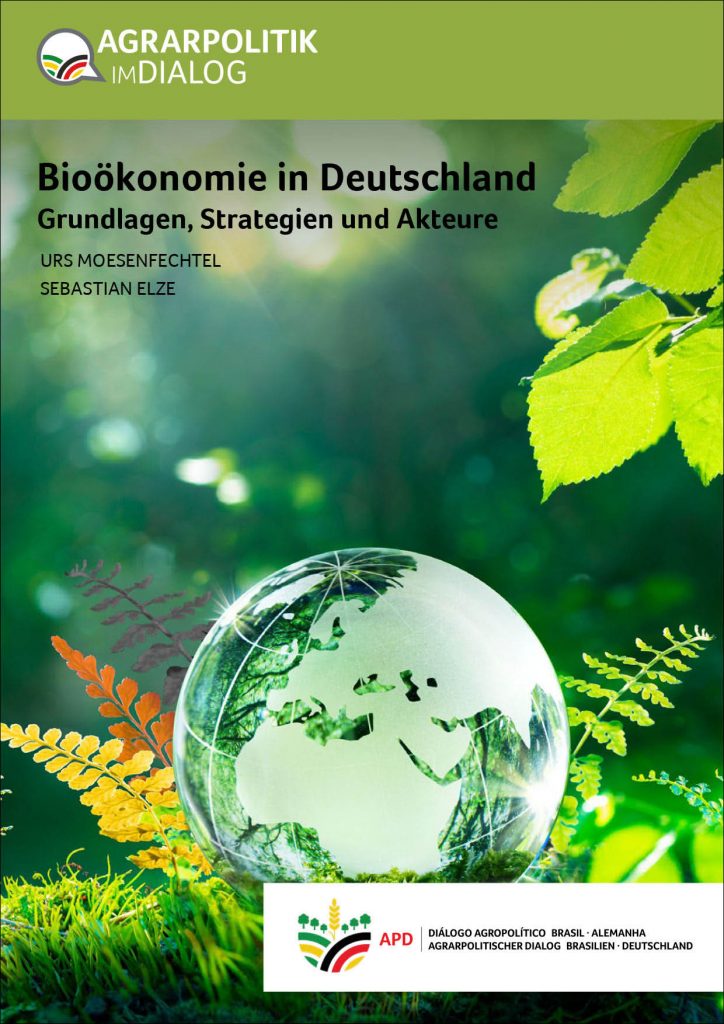 Der vorliegende Text von Urs Moesenfechtel und Sebastian Elze ist das Ergebnis der Zusammenarbeit des Agrarpolitischen Dialogs Brasilien Deutschland mit dem Deutschen Biomassenforschungszentrum, DBFZ.
Der vorliegende Text von Urs Moesenfechtel und Sebastian Elze ist das Ergebnis der Zusammenarbeit des Agrarpolitischen Dialogs Brasilien Deutschland mit dem Deutschen Biomassenforschungszentrum, DBFZ. 


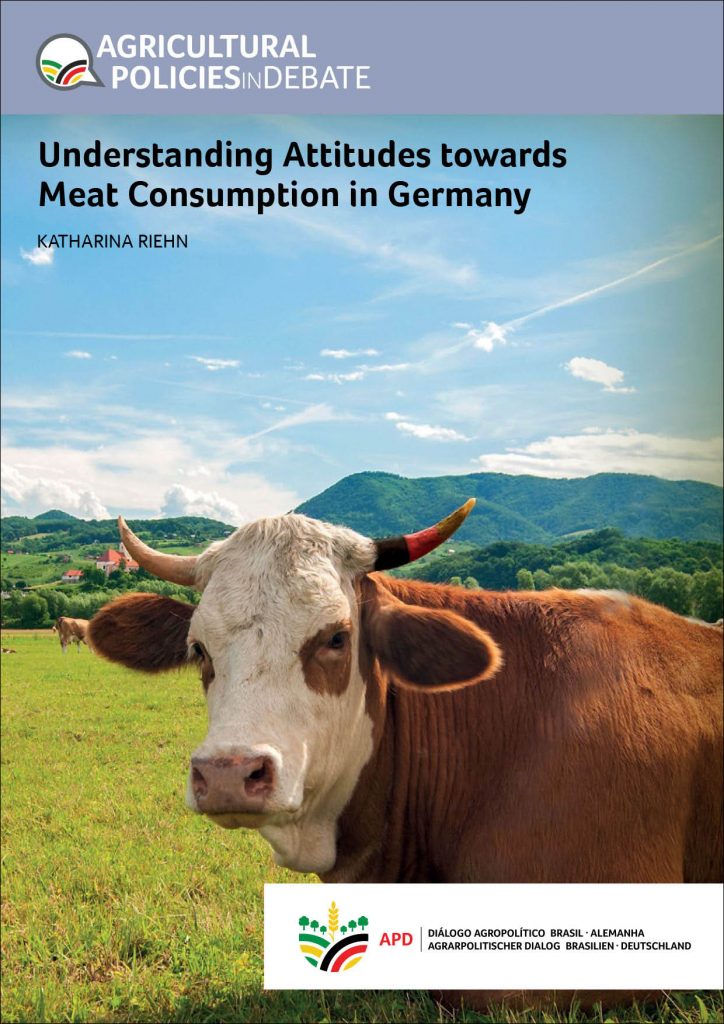 In Deutschland ist das Verständnis weit verbreitet, dass ein verminderter Fleischverzehr nötig ist, um nachhaltiger zu konsumieren, sich klimafreundlicher zu ernähren, das Tierwohl zu fördern und die Artenvielfalt zu erhalten.
In Deutschland ist das Verständnis weit verbreitet, dass ein verminderter Fleischverzehr nötig ist, um nachhaltiger zu konsumieren, sich klimafreundlicher zu ernähren, das Tierwohl zu fördern und die Artenvielfalt zu erhalten.

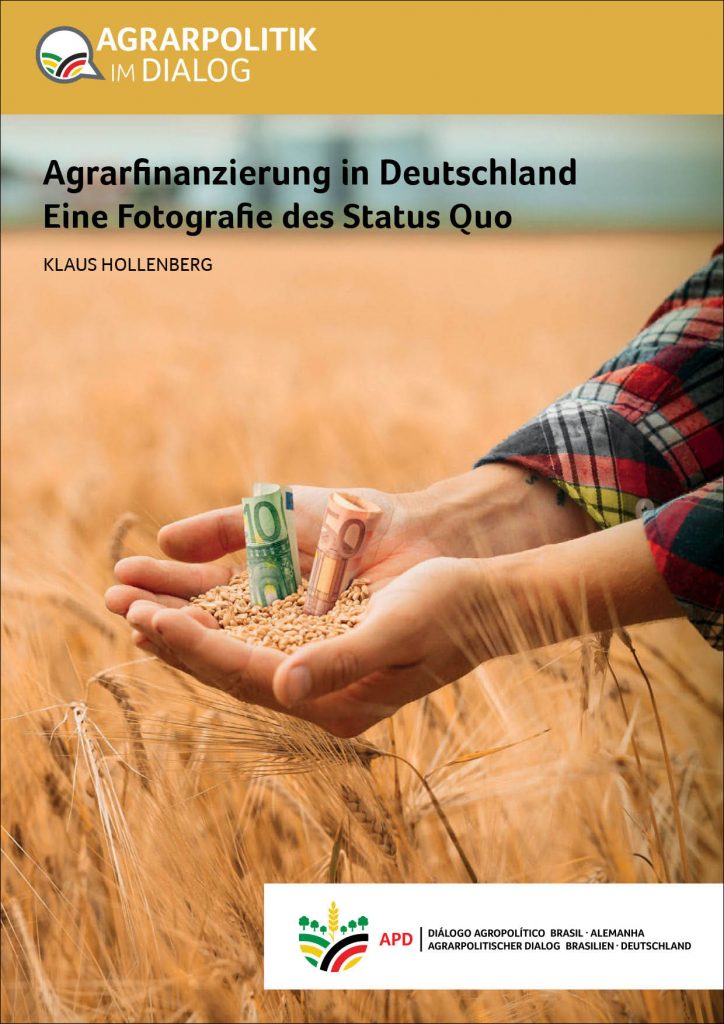 Der vorliegende Text von Klaus Hollenberg, der Rentenbank, liefert Zahlen, Daten, Fakten und anschauliche Grafiken über das Bankensystem und die Finanzierungsstrukturen in der deutschen Landwirtschaft, aber auch die Rolle der Förderbanken und der agrarpolitischen Förderinstrumente der Europäischen Union, des Bundes und der Länder.
Der vorliegende Text von Klaus Hollenberg, der Rentenbank, liefert Zahlen, Daten, Fakten und anschauliche Grafiken über das Bankensystem und die Finanzierungsstrukturen in der deutschen Landwirtschaft, aber auch die Rolle der Förderbanken und der agrarpolitischen Förderinstrumente der Europäischen Union, des Bundes und der Länder. 

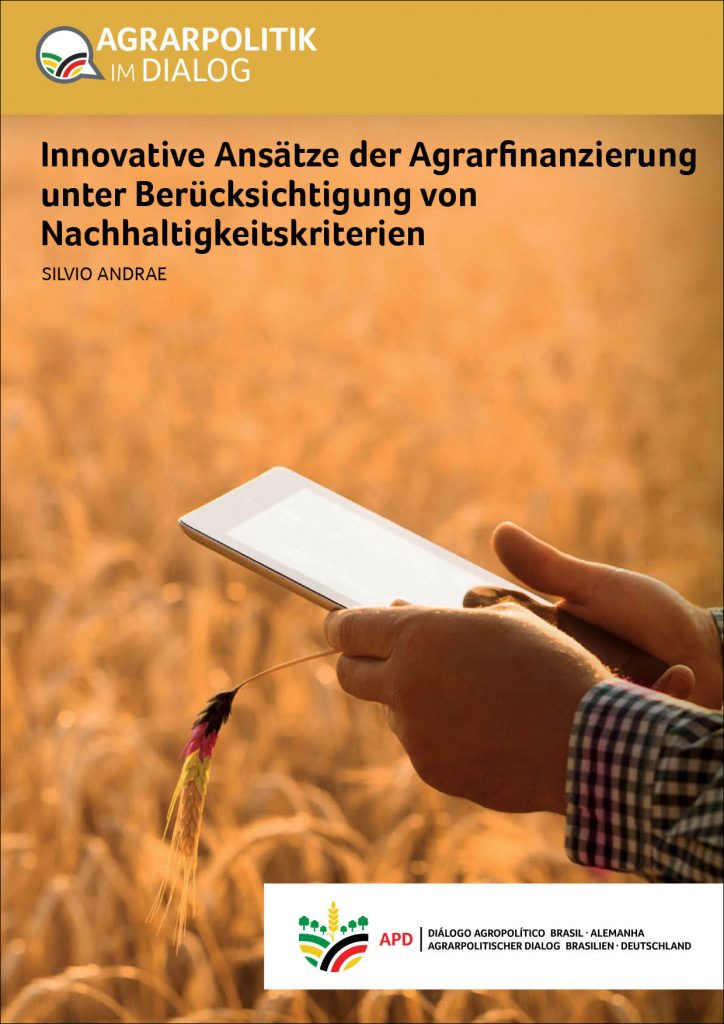 Dieser Artikel von Silvio Andrae beschreibt und analysiert die politischen und wissenschaftlichen Diskussionen in Deutschland und in der Europäischen Union über Innovative Ansätze der Agrarfinanzierung unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien.
Dieser Artikel von Silvio Andrae beschreibt und analysiert die politischen und wissenschaftlichen Diskussionen in Deutschland und in der Europäischen Union über Innovative Ansätze der Agrarfinanzierung unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. 

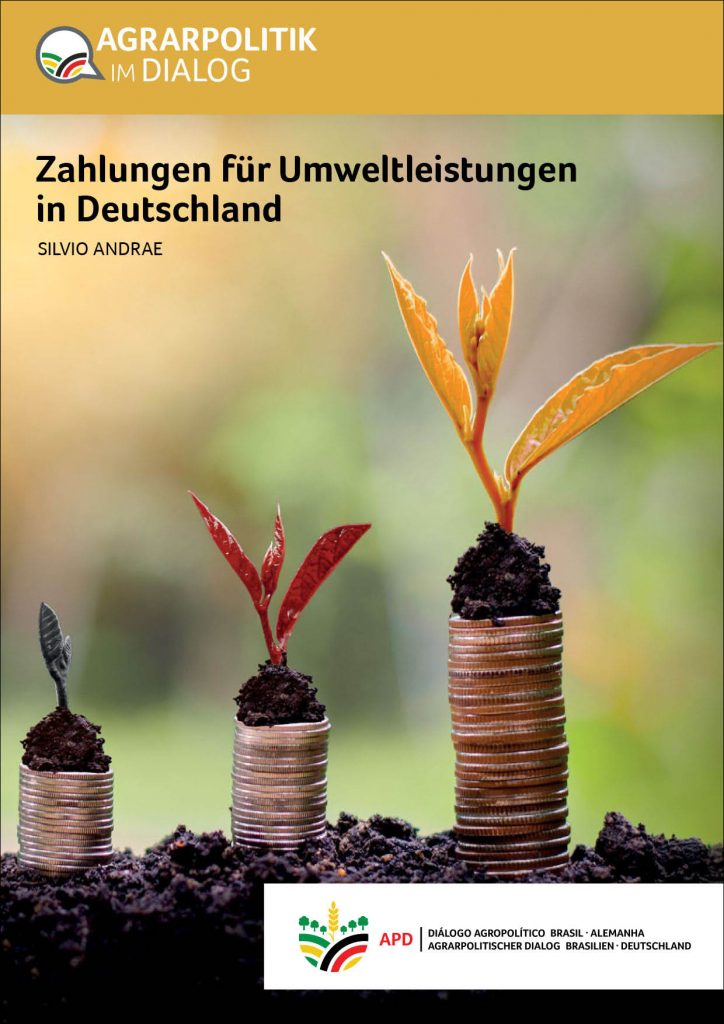 Dieser Artikel von Silvio Andrae beschreibt und analysiert die politischen und wissenschaftlichen Diskussionen über das Instrument der „Bezahlung von Umweltdienstleistungen“ (Payments for Environmental Services – PES), die im Rahmen des Agrarpolitischen Dialogs Brasilien Deutschland – APD geführt werden.
Dieser Artikel von Silvio Andrae beschreibt und analysiert die politischen und wissenschaftlichen Diskussionen über das Instrument der „Bezahlung von Umweltdienstleistungen“ (Payments for Environmental Services – PES), die im Rahmen des Agrarpolitischen Dialogs Brasilien Deutschland – APD geführt werden.




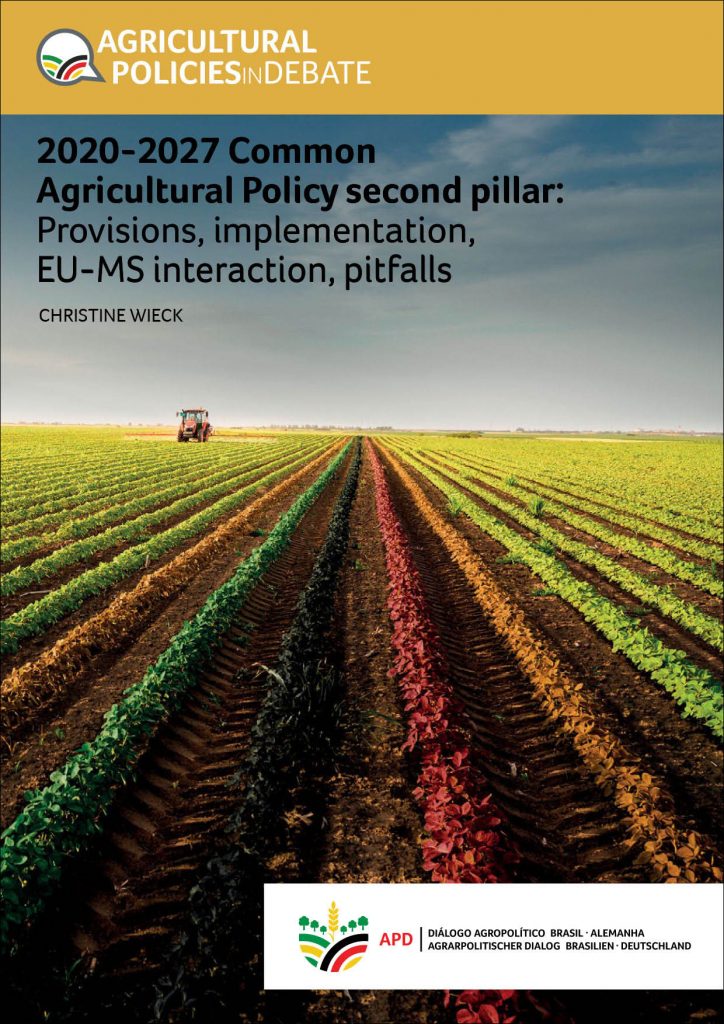 Die Europäische Union (EU) hat sich im Juni 2021 verständigt, um für die neue Phase der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) von 2023 bis 2027 neue Akzente zu setzen. Neue Management- und Monitoring-Formate sollen Fokus, Kohärenz und Zielgenauigkeit der agrarpolitischen Interventionen der EU verbessern.
Die Europäische Union (EU) hat sich im Juni 2021 verständigt, um für die neue Phase der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) von 2023 bis 2027 neue Akzente zu setzen. Neue Management- und Monitoring-Formate sollen Fokus, Kohärenz und Zielgenauigkeit der agrarpolitischen Interventionen der EU verbessern. 