Bio-Landbau und Bio-Markt in Deutschland
 Der Bio-Landbau und der Bio-Markt in Deutschland sind in den vergangenen 20 Jahren rasant gewachsen. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Bio-Fläche mehr als verdreifacht, der Einzelhandelsumsatz mehr als versiebenfacht. Der Bio-Anteil an der Fläche betrug 2022 11 %, der Einzelhandelsumsatz erreichte im Corona-Boom-Jahr 2021 mit 7 % seinen höchsten Anteil. Bei den Verkaufserlösen der Landwirtschaft erreichen die Bio-Landwirte einen Anteil von 7 %.
Der Bio-Landbau und der Bio-Markt in Deutschland sind in den vergangenen 20 Jahren rasant gewachsen. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Bio-Fläche mehr als verdreifacht, der Einzelhandelsumsatz mehr als versiebenfacht. Der Bio-Anteil an der Fläche betrug 2022 11 %, der Einzelhandelsumsatz erreichte im Corona-Boom-Jahr 2021 mit 7 % seinen höchsten Anteil. Bei den Verkaufserlösen der Landwirtschaft erreichen die Bio-Landwirte einen Anteil von 7 %.
Alle Anteile sind noch weit entfernt vom Ziel der deutschen Bundesregierung, bis 2030 einen Bio-Anteil von 30 % aufzuweisen. Dennoch haben viele Maßnahmen das schon jetzt erreichte Ziel unterstützt.
Die Broschüre zeigt Erfolgsfaktoren und Hemmnisse und Perspektiven für die weitere Entwicklung des Öko-Landbaus auf. Dazu werden zuerst Anbau und Produktion beleuchtet, wie sich die zunächst grünlandbasierte Bio-Landwirtschaft über die Jahre intensiviert hat. Die Importe bei Produkten, die auch hier produziert werden können, sind bei den meisten Produkten weniger geworden. Die Preise für Bio-Produkte entwickeln sich sowohl auf Erzeuger- als auch auf Verbraucherebene stabiler als auf den konventionellen Märkten, wodurch Marktentwicklungen zwar besser planbar sind, aber unflexibler reagieren. Die Bio-Verarbeitung entwickelt sich zu immer größeren Strukturen. Der Lebensmitteleinzelhandel übernimmt immer größere Anteile am Bio-Markt, und löst damit die einstigen Pioniere im Naturkosthandel immer mehr ab. Politisch hat die Einführung des deutschen Bio-Siegels die Entwicklung deutlich unterstützt, zuletzt bezieht die Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau die gesamte Branche in den Entwicklungsprozess ein.
Auch wenn der Bio-Markt seit Beginn der Inflation und den damit verbundenen Kostensteigerungen seit Mitte 2022 schwächelt und die Verkaufszahlen erstmals in der Geschichte überhaupt zurückgehen, bedeutet das keine grundsätzliche Kehrtwende. Der Klimawandel und die damit notwendige Agrar- und Ernährungswende sind weiterhin fester Bestandteil der politischen Entscheidungen auf der einen Seite und der Aktivitäten des Handels auf der anderen Seite.
Die AMI-Marktanalysten Hans-Christoph Behr, Diana Schaack, Christine Rampold, Thomas Els und Tim Boenigk haben die unterschiedlichen Themen zur Bio-Markt Entwicklung in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren analysiert und leiten daraus Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft ab.
Autoren

Hans-Christoph Behr

Diana Schaack

Christine Rampold

Thomas Els


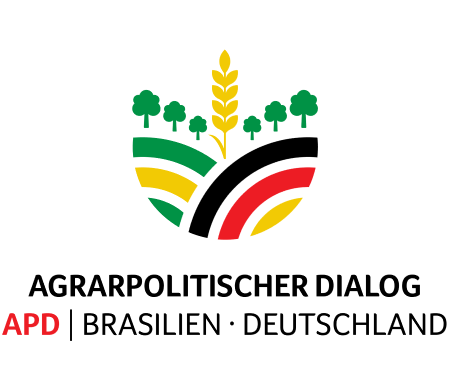



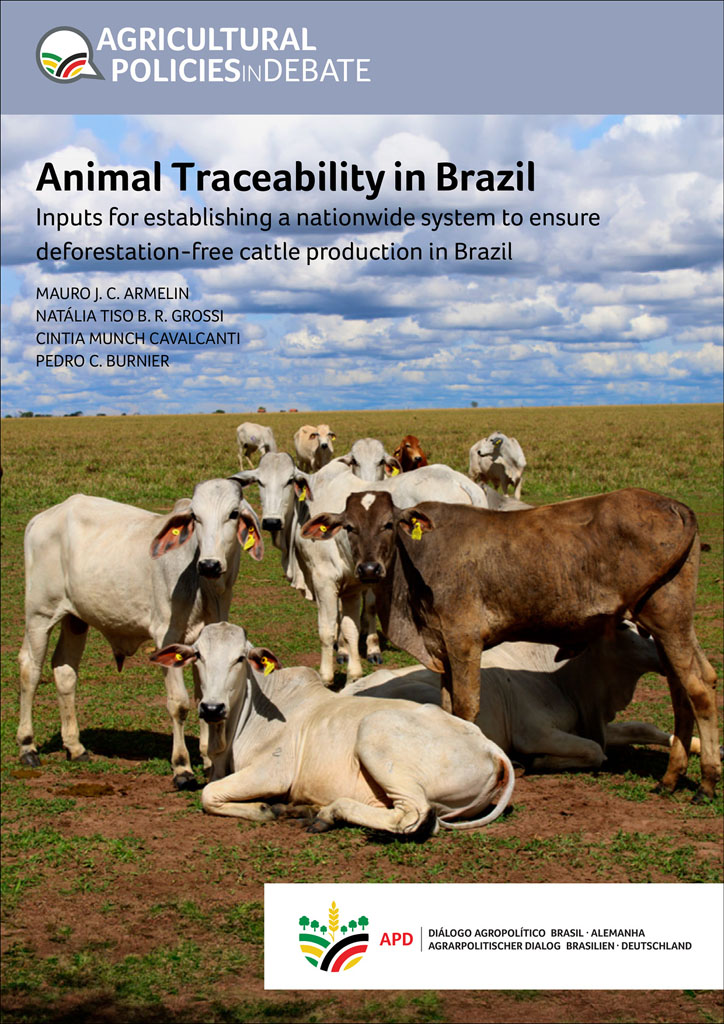





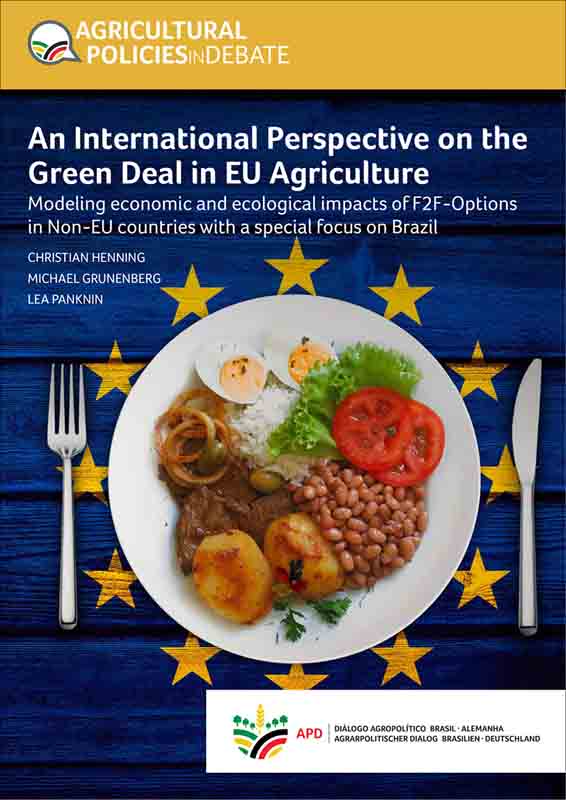 Der Green Deal der EU ist ein ambitionierter Ansatz für eine Dekarbonisierung und nachhaltige Produktionsweise der gesamten europäischen Ökonomie im 21. Jahrhundert. Dies ist eine strategische Neu-Orientierung, mit der Europa auch eine technologische Revolution anstrebt. Politisch ist der Green Deal eine Strategie, die den Anspruch erhebt, Zukunft mitzugestalten und nicht nur zu erleiden.
Der Green Deal der EU ist ein ambitionierter Ansatz für eine Dekarbonisierung und nachhaltige Produktionsweise der gesamten europäischen Ökonomie im 21. Jahrhundert. Dies ist eine strategische Neu-Orientierung, mit der Europa auch eine technologische Revolution anstrebt. Politisch ist der Green Deal eine Strategie, die den Anspruch erhebt, Zukunft mitzugestalten und nicht nur zu erleiden.

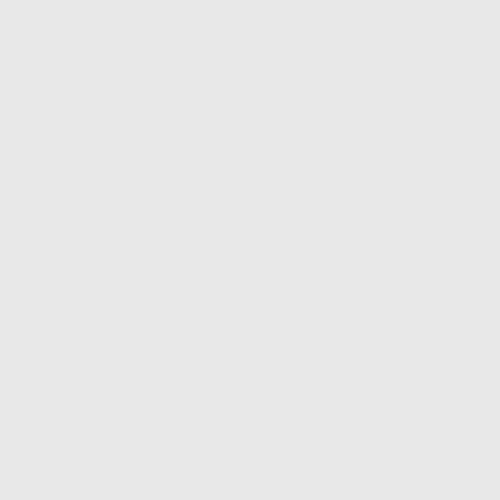

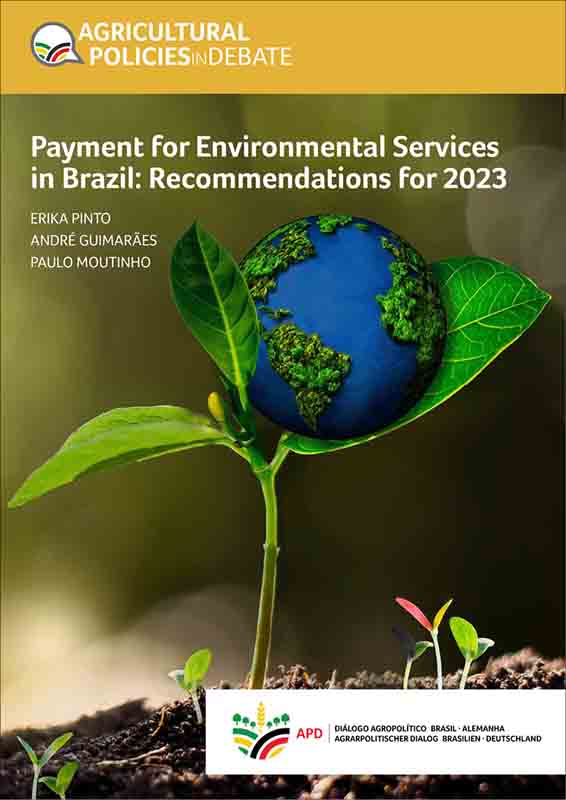 Unzählige Akteure aus der Regierung, der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und dem Privatsektor hatten sich an diesem Prozess beteiligt. Im Januar 2021 dann wurde das Gesetz 14.119 verabschiedet. Es formuliert die „Nationale Politik für die Zahlung von Umweltleistungen“, ein riesiger Schritt für die agrar- und umweltpolitischen Agenda Brasiliens.
Unzählige Akteure aus der Regierung, der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und dem Privatsektor hatten sich an diesem Prozess beteiligt. Im Januar 2021 dann wurde das Gesetz 14.119 verabschiedet. Es formuliert die „Nationale Politik für die Zahlung von Umweltleistungen“, ein riesiger Schritt für die agrar- und umweltpolitischen Agenda Brasiliens.



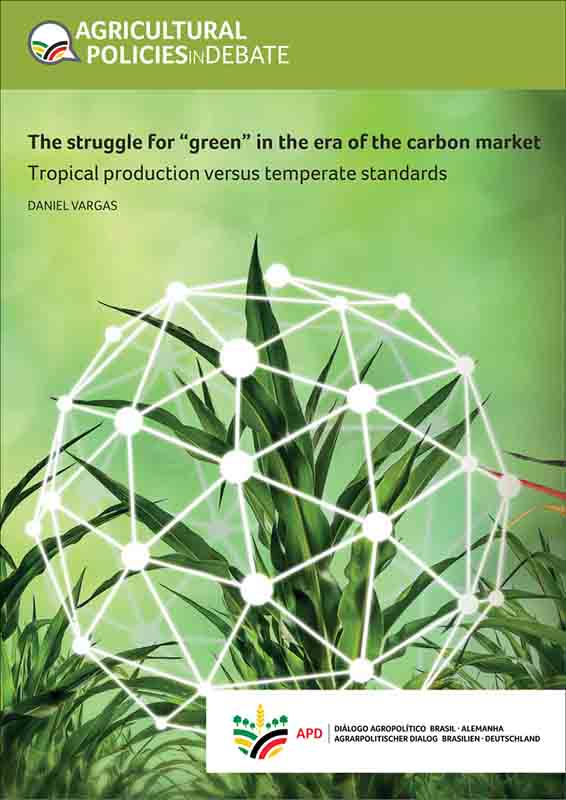 Der vorliegende Essay von Daniel Vargas von der Stiftung Getulio Vargas in São Paulo führt uns literarisch durch die wissenschaftlichen, juristischen, ökonomischen und zweifellos auch politischen Aspekte und Kontroversen über die Funktionsweise der Kohlenstoffmärkte. Er hinterfragt aus der Sicht der großen Potenziale der brasilianischen Landwirtschaft die Maßeinheiten und Regeln, die in den gemäßigten Klimazonen formuliert werden und das Potenzial der Kohlenstoffbindung der tropischen Böden zu unterschätzen scheinen.
Der vorliegende Essay von Daniel Vargas von der Stiftung Getulio Vargas in São Paulo führt uns literarisch durch die wissenschaftlichen, juristischen, ökonomischen und zweifellos auch politischen Aspekte und Kontroversen über die Funktionsweise der Kohlenstoffmärkte. Er hinterfragt aus der Sicht der großen Potenziale der brasilianischen Landwirtschaft die Maßeinheiten und Regeln, die in den gemäßigten Klimazonen formuliert werden und das Potenzial der Kohlenstoffbindung der tropischen Böden zu unterschätzen scheinen.

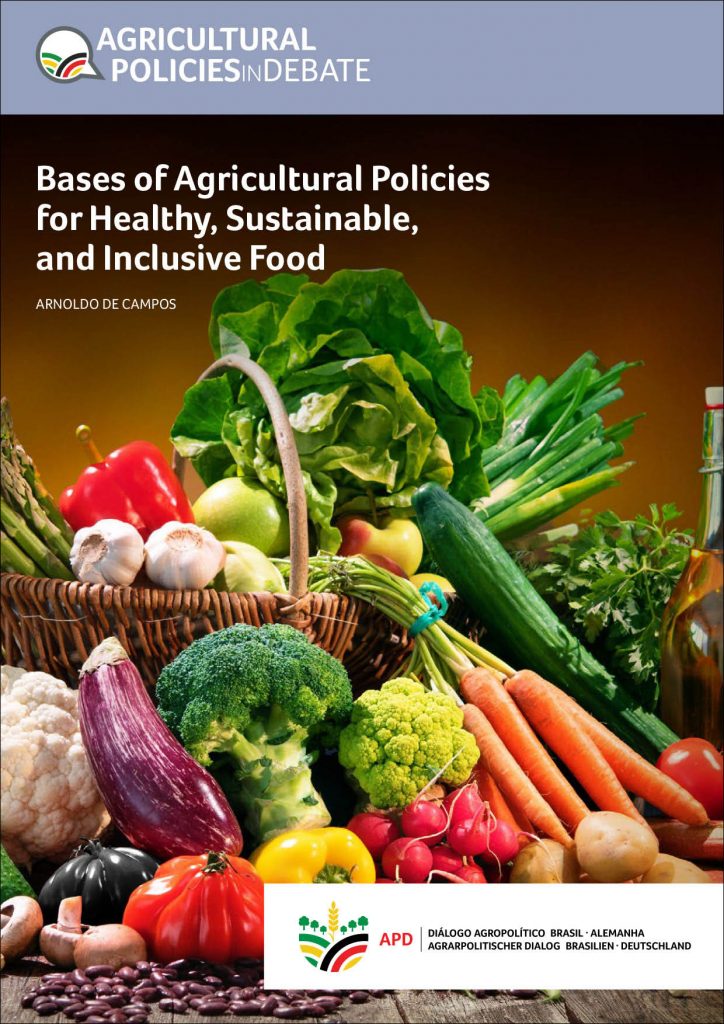 Brasilien formuliert eine eigenständige Agrarpolitik spätestens seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, als Getulio Vargas das Dekret 29.803 von 1951 herausgab. Damals schon betonten die Gesetzgeber die ganze Breite der Zielstellungen der agrarpolitischen Entwicklung: die Stärkung landwirtschaftlichen Produktion und Produktivität, Stabilität der Versorgung, der Märkte und der Preise, die ein ausreichendes Einkommen für die Erzeuger, aber auch bezahlbare Lebensmittel für die Konsumenten garantieren sollten. Bis heute eine aktuelle Agenda!
Brasilien formuliert eine eigenständige Agrarpolitik spätestens seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, als Getulio Vargas das Dekret 29.803 von 1951 herausgab. Damals schon betonten die Gesetzgeber die ganze Breite der Zielstellungen der agrarpolitischen Entwicklung: die Stärkung landwirtschaftlichen Produktion und Produktivität, Stabilität der Versorgung, der Märkte und der Preise, die ein ausreichendes Einkommen für die Erzeuger, aber auch bezahlbare Lebensmittel für die Konsumenten garantieren sollten. Bis heute eine aktuelle Agenda!

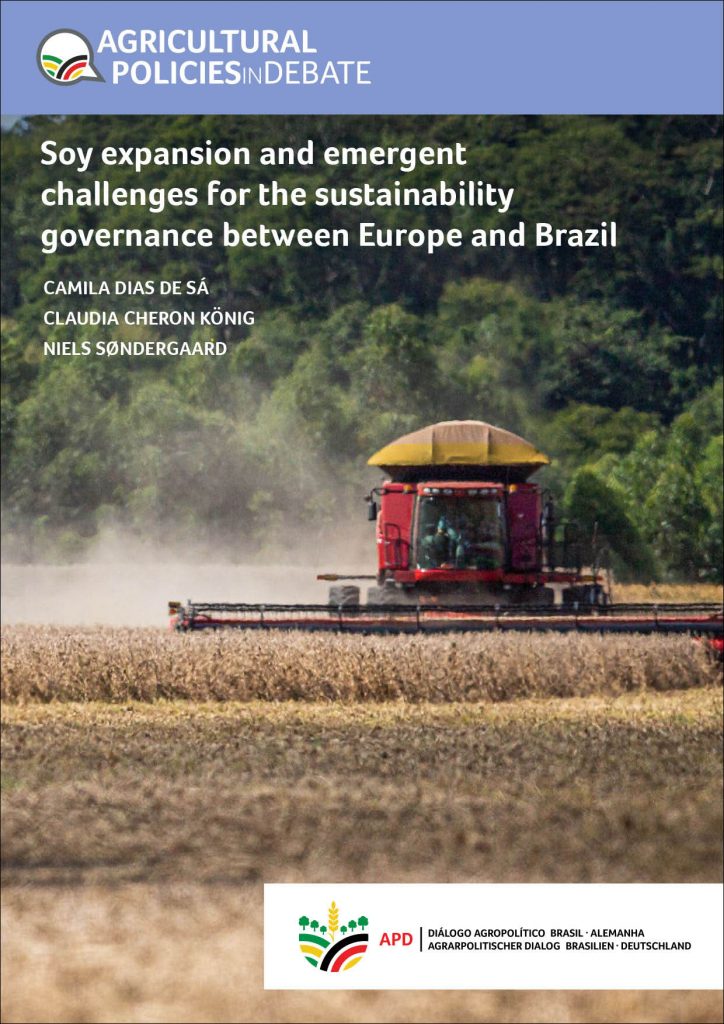 Der vorliegende englischsprachige Beitrag von Camila Dias de Sá vom Think Tank INSPER Agro Global, Claudia Cheron König, Fundação José Luiz Egydio Setúbal sowie Niels Søndergaard, von der Universität von Brasília, zeigt den Stand der aktuellen wissenschaftlichen Debatte in Brasilien zur Produktion und Expansion der Soja und Initiativen, die den Marktakteuren eine höhere Verantwortung für soziale und Umweltfragen überträgt.
Der vorliegende englischsprachige Beitrag von Camila Dias de Sá vom Think Tank INSPER Agro Global, Claudia Cheron König, Fundação José Luiz Egydio Setúbal sowie Niels Søndergaard, von der Universität von Brasília, zeigt den Stand der aktuellen wissenschaftlichen Debatte in Brasilien zur Produktion und Expansion der Soja und Initiativen, die den Marktakteuren eine höhere Verantwortung für soziale und Umweltfragen überträgt.



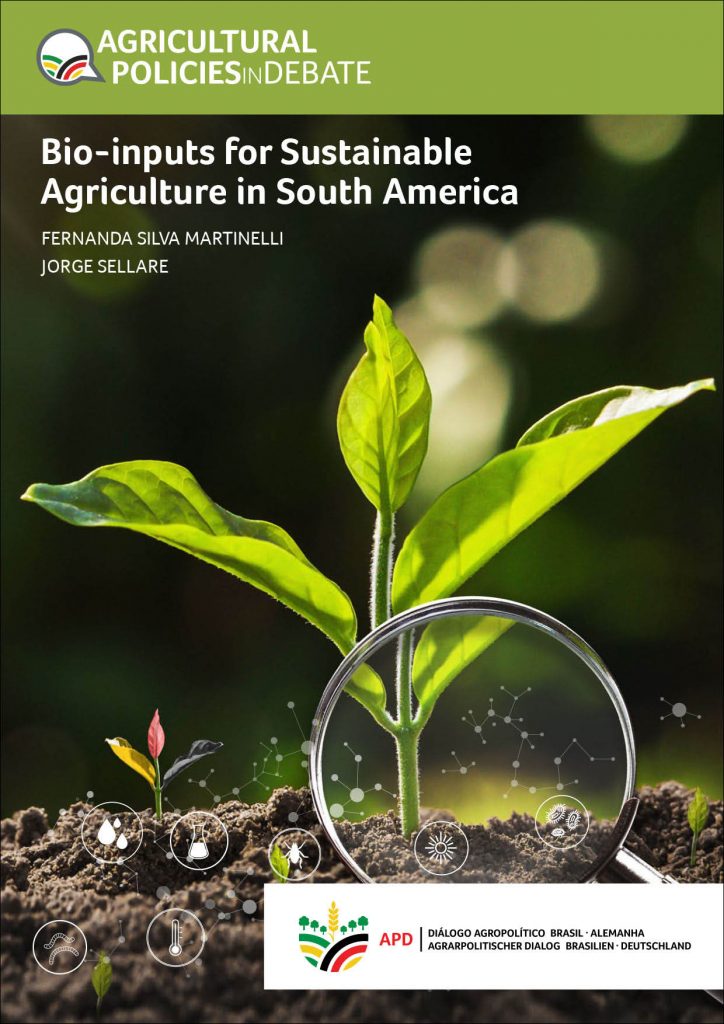 Bio-inputs for agricultural production, such as those based on microbiome or microorganism, are often portrayed as promising technologies to reduce our reliance on fossil-based inputs and increase productivity while contributing to environmental sustainability (e.g. increased soil carbon sequestration, soil restoration, and reduced methane emissions from ruminants).
Bio-inputs for agricultural production, such as those based on microbiome or microorganism, are often portrayed as promising technologies to reduce our reliance on fossil-based inputs and increase productivity while contributing to environmental sustainability (e.g. increased soil carbon sequestration, soil restoration, and reduced methane emissions from ruminants). 

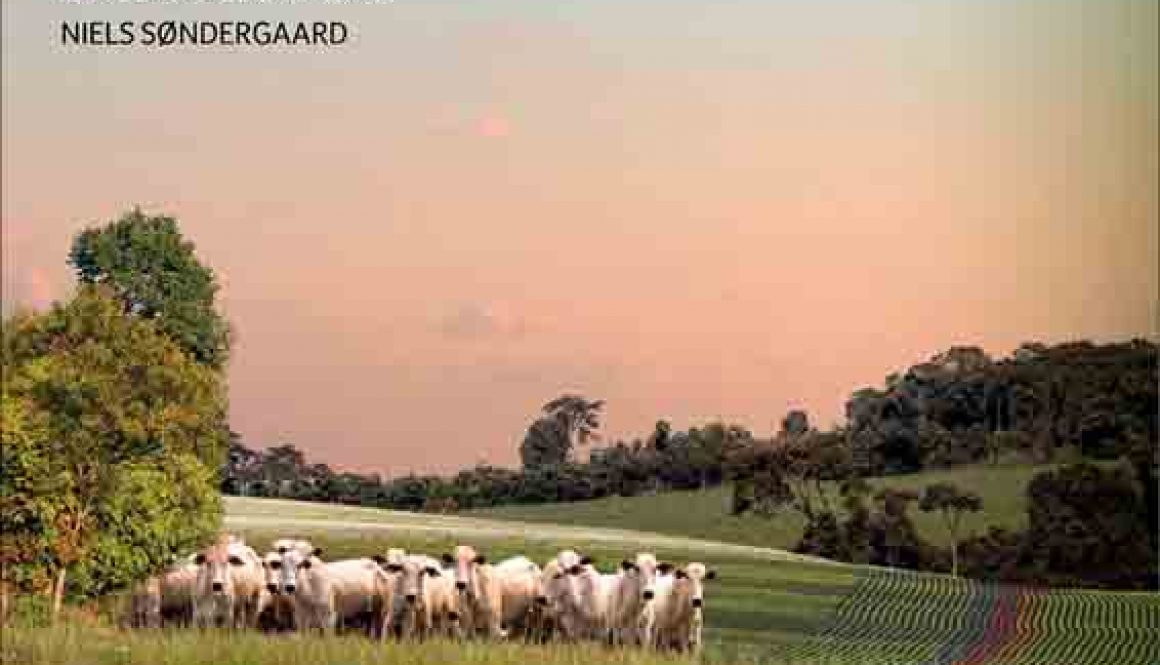
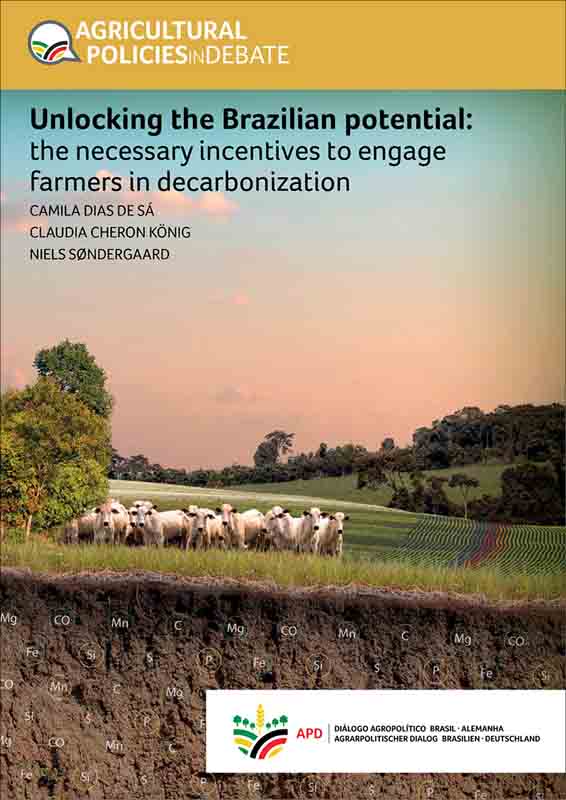 Der vorliegende englischsprachige Beitrag von Camila Dias de Sá und Claudia Cheron König, und Niels Søndergaard zeigt den aktuellen wissenschaftlichen Diskussionsstand zum Thema Carbon Farming und Carbon Markets.
Der vorliegende englischsprachige Beitrag von Camila Dias de Sá und Claudia Cheron König, und Niels Søndergaard zeigt den aktuellen wissenschaftlichen Diskussionsstand zum Thema Carbon Farming und Carbon Markets. 
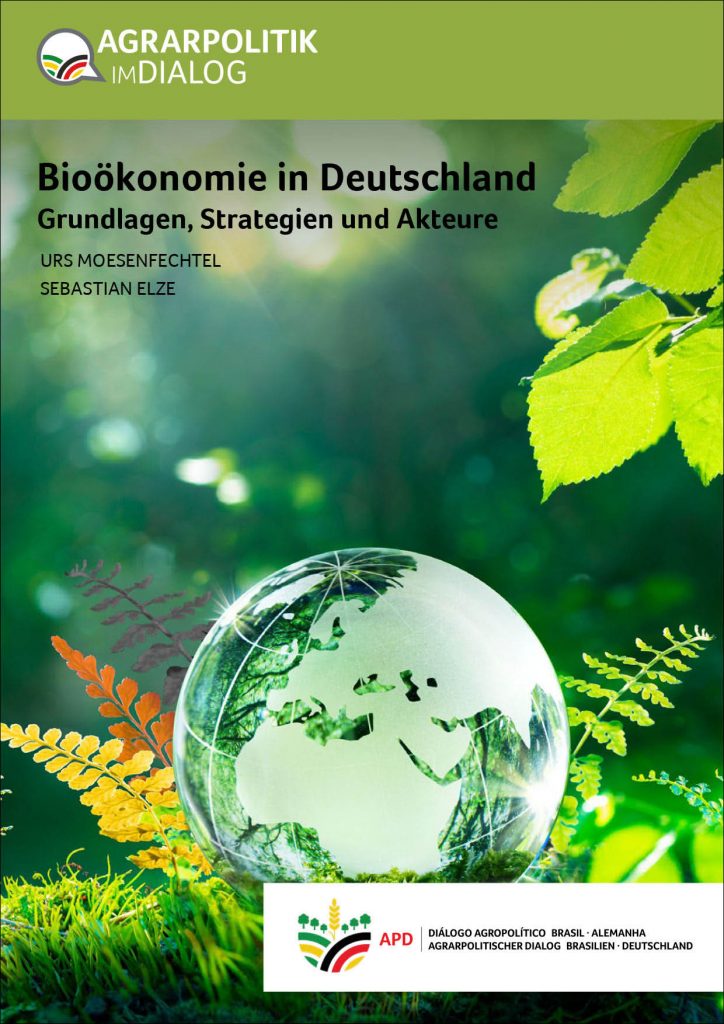 Der vorliegende Text von Urs Moesenfechtel und Sebastian Elze ist das Ergebnis der Zusammenarbeit des Agrarpolitischen Dialogs Brasilien Deutschland mit dem Deutschen Biomassenforschungszentrum, DBFZ.
Der vorliegende Text von Urs Moesenfechtel und Sebastian Elze ist das Ergebnis der Zusammenarbeit des Agrarpolitischen Dialogs Brasilien Deutschland mit dem Deutschen Biomassenforschungszentrum, DBFZ. 
