Während der Amtszeit von Bolsonaro profitierte ein Teil der brasilianischen Agrar- und Ernährungswirtschaft von verschiedenen außenpolitischen Ereignissen, die die Rohstoffpreise in die Höhe trieben. Die Schweinepest, die Corona-Pandemie, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine und die Abwertung des Real gegenüber dem Dollar trugen dazu bei, die brasilianische Agrarproduktion und die Exporte anzukurbeln. Die Agrar- und Ernährungswirtschaft als Ganzes macht im historischen Durchschnitt etwa 23 % des brasilianischen BIP aus – wenn man die der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten Dienstleistungen und Industrien mit einbezieht (die Landwirtschaft allein macht etwa 5% des BIP aus). Hinter diesen kurzfristigen Gewinnen verbergen sich allerdings erhebliche Rückschläge für die wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit des Sektors.
In den letzten drei Jahren hat die illegale Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet deutlich zugenommen, was den veränderten Vorgaben der Umweltpolitik unter der Regierung Bolsonaros entsprach. Daten der Satellitenüberwachung aus dem Programm PRODES zeigen, dass die Entwaldung in der Region in den Jahren 2019 und 2020 um 79 % bzw. 74 % im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2010-18 zugenommen hat. Waldbrände nahmen 2019 um 3 % und 2020 um 22 % im Vergleich zum Durchschnitt des vorangegangenen Zeitraums zu. Der Anstieg der Entwaldungsraten und der damit verbundenen CO2-Emissionen in jener Region, die wir „Amazônia Legal“ nennen, ist eine Folge der Demontage von Bundesumweltbehörden, die für die Durchsetzung der Gesetze zuständig waren, insbesondere nach 2018, als Kontrollen und Verstöße die geringste Zahl von Anzeigen und Geldstrafen in den letzten zehn Jahren zur Folge hatten. Zwischen 2010 und 2018 wurden im Durchschnitt 4700 Verstöße gegen die Flora des Amazonasgebietes (meist illegale Abholzung) zur Anzeige gebracht. Im Jahr 2019 ging diese Zahl auf rund 3300 und im Jahr 2020 auf 2200 zurück, das entspricht einem Rückgang von 30 % bzw. 54 %. Infolge der Erwartung von Straffreiheit und Verjährung wurden 93 % der dennoch verhängten Umweltstrafen während der Amtszeit 2018-2022 nicht bezahlt.
Noch vor seiner offiziellen Vereidigung hielt Präsident Luís Inácio Lula da Silva auf der 27. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 27) im vergangenen November in Ägypten eine Rede voller Enthusiasmus und Hoffnung. Lula kritisierte die von seinem Vorgänger vorangetriebene Isolierung des Landes und betonte, dass Brasilien zurück sei auf der Bühne der internationalen Umwelt- und Klimaagenda. Er betonte auch, dass die Regierung keine Mühen scheuen werde, um die illegale und legale Abholzung zu bekämpfen, und den indigenen Völker mit der Schaffung des Ministeriums für indigene Völker eine Stimme zu geben.
Als Lula sein Amt antrat, ernannte er als erste Amtshandlung die indigene Abgeordnete Sônia Guajajara für das Ministerium für indigene Völker. Marina Silva, Lulas frühere Umweltministerin zwischen 2003-2005 wurde erneut Ministerin für Umwelt und Klimawandel, und Lula bestätigte die Einrichtung der Nationalen Behörde für Klimawandel, des Klimasicherheitsrats, des Außerordentlichen Sekretariats für die Bekämpfung der Entwaldung sowie die Schaffung, Reaktivierung oder Verlegung anderer wichtiger Arbeitsgruppen, die während der letzten Regierung bewusst vom Umweltministerium ferngehalten worden waren. Darüber hinaus unterzeichnete Lula an seinem ersten Tag im Amt die vollständige oder teilweise Aufhebung verschiedener umweltfeindlicher Dekrete seines Vorgängers. Genehmigungen für Bergbau und Goldabbau in indigenen Gebieten wurden widerrufen, der Amazonas-Fonds wurde wieder eingeführt, Vertreter der Zivilgesellschaft wurden wieder in den brasilianischen Umweltrat berufen, 50 % der Bußgelder für Umweltvergehen fließen wieder in den nationalen Umweltfonds zurück. Und schließlich wurde der Aktionsplan zur Vermeidung und Kontrolle der Entwaldung im Amazonas (PPCDAm) wieder aufgenommen. Der PPCDAm wurde 2004 von der damaligen – und aktuellen – Umweltministerin ins Leben gerufen und war für einen Rückgang der Entwaldung im Amazonasgebiet zwischen 2004 und 2012 um 83 % verantwortlich.
Die Umstände sind für die brasilianische Agrarwirtschaft mehr als günstig, da wichtige Handelspartner des Landes wie die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Europa und sogar China bereits ein wachsendes Interesse daran zeigen, die Abholzung in ihren Lieferketten zu reduzieren oder ganz aufzuheben, um den Forderungen der immer anspruchsvolleren Märkte und Verbraucher in Bezug auf die Herkunft der in ihren Ländern konsumierten Produkte gerecht zu werden. Die bereits vorgelegten und diskutierten Rechtsvorschriften umfassen in einer ersten Phase die Lieferketten Soja, Rindfleisch, Leder, Kaffee, Kakao, Holz, Kautschuk und Pflanzenöl.
Im Dezember 2022 wurden die Verhandlungen zwischen der Kommission, dem Rat und dem Europäischen Parlament abgeschlossen und der endgültige Wortlaut der Maßnahmen zur Regelung der Einfuhr entwaldungsfreier Produkte nach Europa wird bereits für Anfang 2023 erwartet und soll Ende 2024 in Kraft treten. Nach dieser Verordnung dürfen die (oben aufgelisteten) relevanten Waren und Produkte nur dann auf den europäischen Markt gelangen oder aus der EU ausgeführt werden, wenn sie nachweislich (a) entwaldungsfrei sind, (b) in Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes hergestellt wurden (z. B. dem brasilianischen Forstgesetz) und (c) durch eine Sorgfaltserklärung eines Importeurs oder Exporteurs abgedeckt sind. In Haft genommen wird der Importeur oder Exporteur, der die Ware zuerst auf den EU-Markt bringt oder aus der EU ausführt.
In dieser Sorgfaltspflichtregelung sind (a) Informationen über den Ursprung des Produkts, (b) Risikobewertung des Produktionslandes und (c) Risikominderung gefordert. Es ist an ein Länder-Benchmark-System gekoppelt, das die Sorgfaltspflichten (strenger für Länder mit größerer Abholzung und für große Akteure) entsprechend der Risikoklassifizierung jedes Landes (und subnationaler Region) anpasst. Diese Verordnung macht deutlich, dass eine effiziente und transparente Rückverfolgbarkeit der Produktionsketten, die Aufschluss über die Herkunft eines bestimmten Produkts gibt, der Schlüssel zum Erfolg dieser Maßnahmen und zur Aufrechterhaltung des Zugangs brasilianischer Produkte zu diesen Märkten ist. Neben der Europäischen Union haben Großbritannien, Frankreich und Deutschland bereits spezifische Rechtsvorschriften verabschiedet, und auch die Vereinigten Staaten bewegen sich in diese Richtung. Weniger eindeutig, aber dennoch unmissverständlich haben sich auch die chinesische Regierung und große chinesische Unternehmen verpflichtet, nur noch Produkte zu kaufen, die nachweislich die Umweltgesetzen der jeweiligen Exportländer einhalte.
Die Einführung von Systemen, die der wachsenden Nachfrage nach Rückverfolgbarkeit der landwirtschaftlichen und tierischen Produktion gerecht werden, stellt eine große technische und politische Herausforderung dar. Es gibt jedoch bereits konkrete Lösungen, die landesweit ausgedehnt werden können.
Das System der grünen Zertifikats SeloVerde, das von den Bundesstaaten Pará und seit kurzem auch von Minas Gerais eingeführt wurde, ist derzeit das fortschrittlichste sozial-ökologische Rückverfolgbarkeitssystem in Brasilien zur Bewertung der Illegalität und zur Unterstützung der Sorgfaltspflicht von waldfreien landwirtschaftlichen Ketten. Es ist das erste öffentliche und transparente System zur Rückverfolgbarkeit in Brasilien, das die illegale Abholzung von direkten und indirekten Rinderlieferanten bewertet, und auch auf andere Rohstoffe ausgeweitet werden kann. Das Zertifikat SeloVerde verwendet Datenbanken mit folgenden Informationen: (a) Satellitenüberwachung der Entwaldung; (b) öffentliche, indigene und Naturschutzgebiete; (c) Registrierung von Privatgrundstücken in den Bundesstaaten und auf nationaler Ebene (mit dem neuen Forstgesetz von 2012 wurde die Eintragung aller ländlichen Grundstücke in das Umweltregister für den ländlichen Raum – CAR – verbindlich vorgeschrieben); (d) Umweltstrafen und Embargos für Erzeuger; (e) Einsatz von Praktiken der Sklavenarbeit; (f) Viehtransporte (durch Aufzeichnungen über Tiertransporte, die bei den landwirtschaftlichen Gesundheitsschutzbehörden gemeldet werden).
Die aktuelle Version des Zertifikats SeloVerde in Pará enthält Informationen über mehr als 250.000 Viehzuchtbetriebe und kann auf der Website des Umweltministeriums des Bundeslands Pará öffentlich eingesehen werden. Hierzu können 30 täglich aktualisierte Datensätze von 12 Bundes- und Landesbehörden analysiert und integriert werden, um in einem einheitlichen System die meisten der Informationen bereitzustellen, die für die Durchführung der ersten Phase des in der europäischen Verordnung geforderten Due-Diligence-Prozesses erforderlich sind. Die Verordnungen anderer Länder weisen in der Regel ähnliche Grundsätze und Anforderungen wie die der EU auf, auch wenn einige noch in der Diskussion sind. Vor der Einführung des SeloVerde stützten sich die Märkte auf private Zertifizierungen, die für die landwirtschaftlichen (Klein)Betriebe (viele von ihnen indirekte Lieferanten) häufig unzugänglich waren und nur einen kleinen Teil der Betriebe abdeckten und allgemein an Transparenz zu wünschen übrigließen. Da SeloVerde ein staatliches System ist, basiert es auf persönlichen und sensiblen Daten, die privaten Zertifizierern und kommerziellen Systemen, die derzeit von den meisten Betreibern und Schlachthöfen verwendet werden, nicht zur Verfügung stehen. Gleichzeitig schützt das System diese sensiblen Daten und zeigt nur die Informationen an, die notwendig sind, um die Umweltkonformität der landwirtschaftlichen Produktion auf der Ebene des Betriebs zu zertifizieren. Schließlich ist das SeloVerde für den Erzeuger mit keinerlei Kosten verbunden, da die Analysen automatisch auf der Grundlage der verpflichtenden Umwelt- und Gesundheitsdaten durchgeführt werden.
Die Fortschritte bei der Rückverfolgbarkeit in Pará gehen konform mit dem Diskurs von Präsident Lula, die Entwaldung zu stoppen, und mit den neuen Anforderungen der internationalen Märkte, insbesondere der Europäischen Union. Für 2023 und darüber hinaus sollen die politischen Intentionen und Normen tatsächlich mit der praktischen Anwendung von Instrumenten und Systemen in Einklang gebracht werden, die eine nachhaltigere Entwicklung nicht nur für die brasilianische Agrarwirtschaft und das Amazonasgebiet, sondern die Dekarbonisierung der Produktionsketten im ganzen Land fördern.


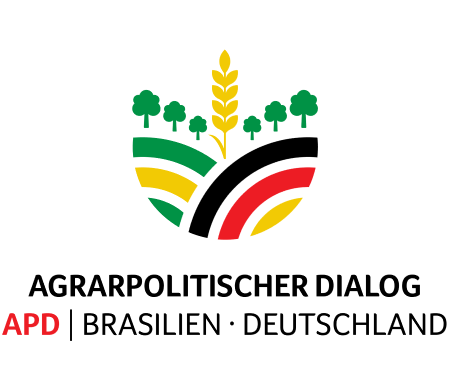






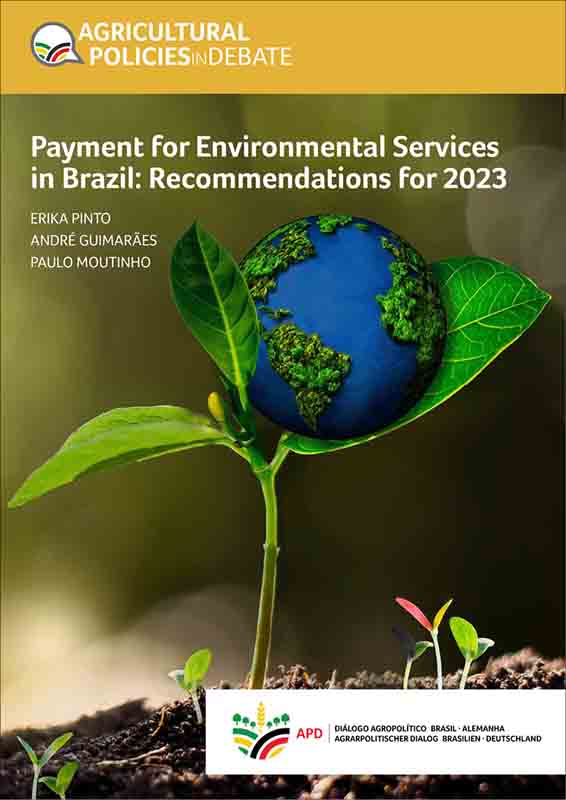 Unzählige Akteure aus der Regierung, der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und dem Privatsektor hatten sich an diesem Prozess beteiligt. Im Januar 2021 dann wurde das Gesetz 14.119 verabschiedet. Es formuliert die „Nationale Politik für die Zahlung von Umweltleistungen“, ein riesiger Schritt für die agrar- und umweltpolitischen Agenda Brasiliens.
Unzählige Akteure aus der Regierung, der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und dem Privatsektor hatten sich an diesem Prozess beteiligt. Im Januar 2021 dann wurde das Gesetz 14.119 verabschiedet. Es formuliert die „Nationale Politik für die Zahlung von Umweltleistungen“, ein riesiger Schritt für die agrar- und umweltpolitischen Agenda Brasiliens.



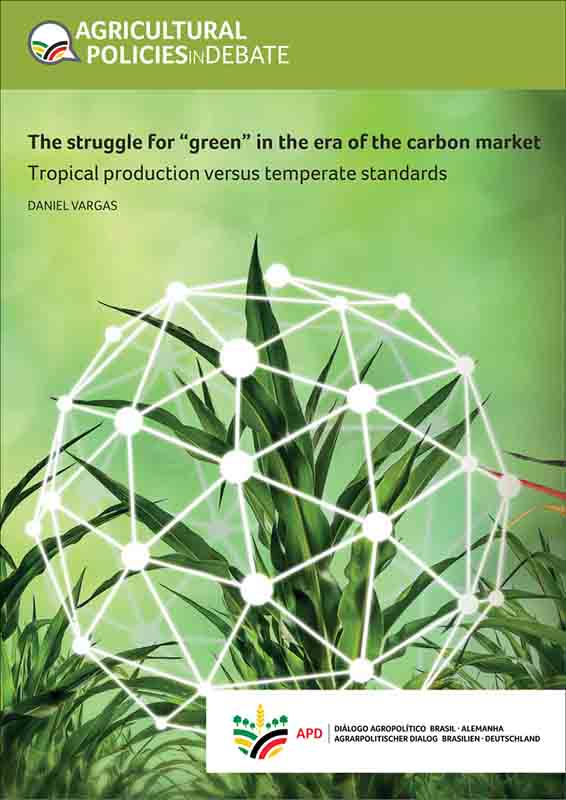 Der vorliegende Essay von Daniel Vargas von der Stiftung Getulio Vargas in São Paulo führt uns literarisch durch die wissenschaftlichen, juristischen, ökonomischen und zweifellos auch politischen Aspekte und Kontroversen über die Funktionsweise der Kohlenstoffmärkte. Er hinterfragt aus der Sicht der großen Potenziale der brasilianischen Landwirtschaft die Maßeinheiten und Regeln, die in den gemäßigten Klimazonen formuliert werden und das Potenzial der Kohlenstoffbindung der tropischen Böden zu unterschätzen scheinen.
Der vorliegende Essay von Daniel Vargas von der Stiftung Getulio Vargas in São Paulo führt uns literarisch durch die wissenschaftlichen, juristischen, ökonomischen und zweifellos auch politischen Aspekte und Kontroversen über die Funktionsweise der Kohlenstoffmärkte. Er hinterfragt aus der Sicht der großen Potenziale der brasilianischen Landwirtschaft die Maßeinheiten und Regeln, die in den gemäßigten Klimazonen formuliert werden und das Potenzial der Kohlenstoffbindung der tropischen Böden zu unterschätzen scheinen.

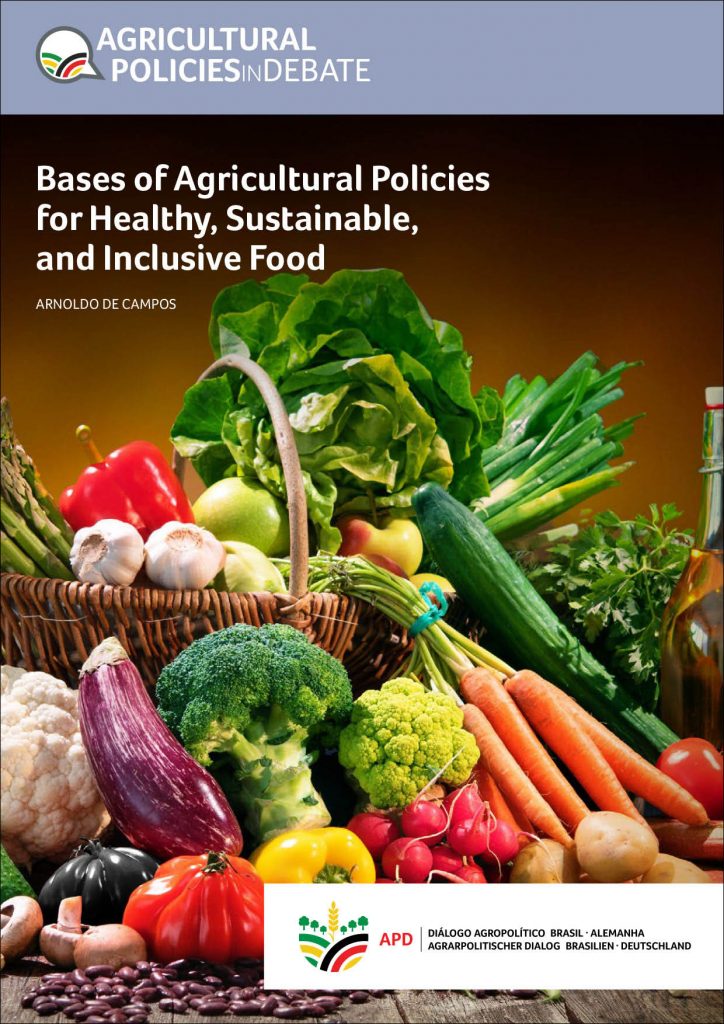 Brasilien formuliert eine eigenständige Agrarpolitik spätestens seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, als Getulio Vargas das Dekret 29.803 von 1951 herausgab. Damals schon betonten die Gesetzgeber die ganze Breite der Zielstellungen der agrarpolitischen Entwicklung: die Stärkung landwirtschaftlichen Produktion und Produktivität, Stabilität der Versorgung, der Märkte und der Preise, die ein ausreichendes Einkommen für die Erzeuger, aber auch bezahlbare Lebensmittel für die Konsumenten garantieren sollten. Bis heute eine aktuelle Agenda!
Brasilien formuliert eine eigenständige Agrarpolitik spätestens seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, als Getulio Vargas das Dekret 29.803 von 1951 herausgab. Damals schon betonten die Gesetzgeber die ganze Breite der Zielstellungen der agrarpolitischen Entwicklung: die Stärkung landwirtschaftlichen Produktion und Produktivität, Stabilität der Versorgung, der Märkte und der Preise, die ein ausreichendes Einkommen für die Erzeuger, aber auch bezahlbare Lebensmittel für die Konsumenten garantieren sollten. Bis heute eine aktuelle Agenda!





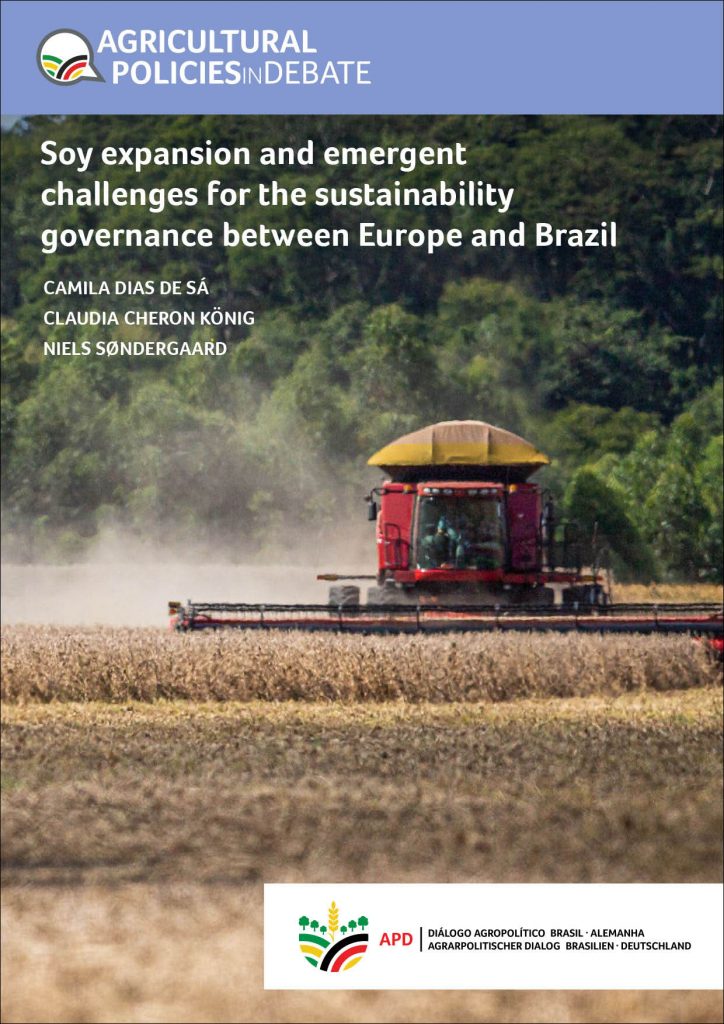 Der vorliegende englischsprachige Beitrag von Camila Dias de Sá vom Think Tank INSPER Agro Global, Claudia Cheron König, Fundação José Luiz Egydio Setúbal sowie Niels Søndergaard, von der Universität von Brasília, zeigt den Stand der aktuellen wissenschaftlichen Debatte in Brasilien zur Produktion und Expansion der Soja und Initiativen, die den Marktakteuren eine höhere Verantwortung für soziale und Umweltfragen überträgt.
Der vorliegende englischsprachige Beitrag von Camila Dias de Sá vom Think Tank INSPER Agro Global, Claudia Cheron König, Fundação José Luiz Egydio Setúbal sowie Niels Søndergaard, von der Universität von Brasília, zeigt den Stand der aktuellen wissenschaftlichen Debatte in Brasilien zur Produktion und Expansion der Soja und Initiativen, die den Marktakteuren eine höhere Verantwortung für soziale und Umweltfragen überträgt.



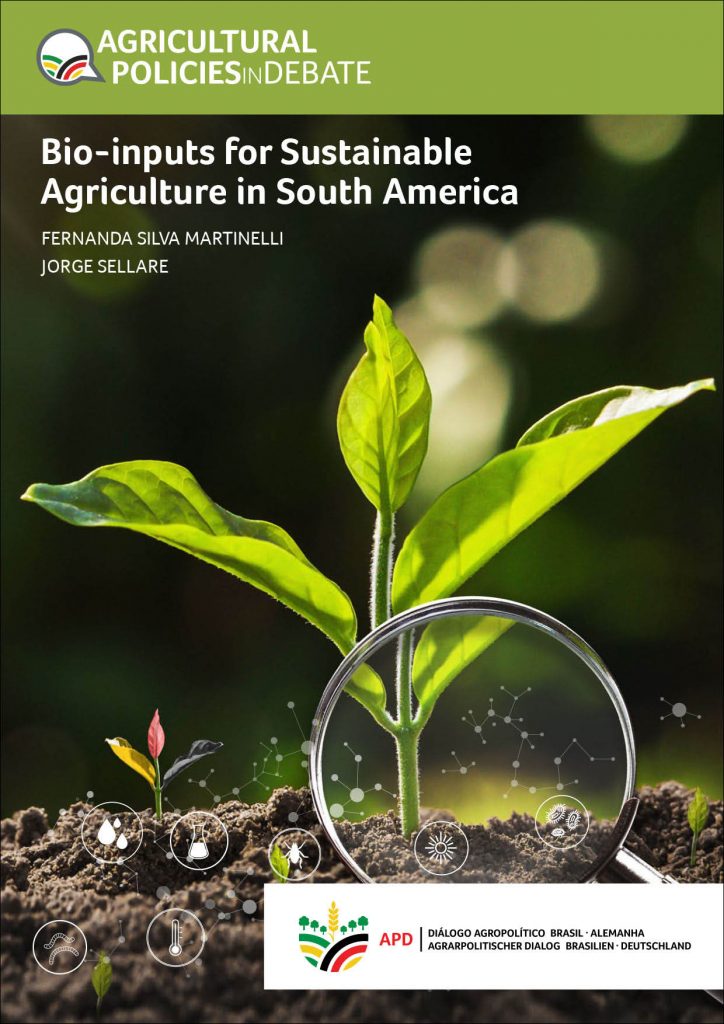 Bio-inputs for agricultural production, such as those based on microbiome or microorganism, are often portrayed as promising technologies to reduce our reliance on fossil-based inputs and increase productivity while contributing to environmental sustainability (e.g. increased soil carbon sequestration, soil restoration, and reduced methane emissions from ruminants).
Bio-inputs for agricultural production, such as those based on microbiome or microorganism, are often portrayed as promising technologies to reduce our reliance on fossil-based inputs and increase productivity while contributing to environmental sustainability (e.g. increased soil carbon sequestration, soil restoration, and reduced methane emissions from ruminants). 

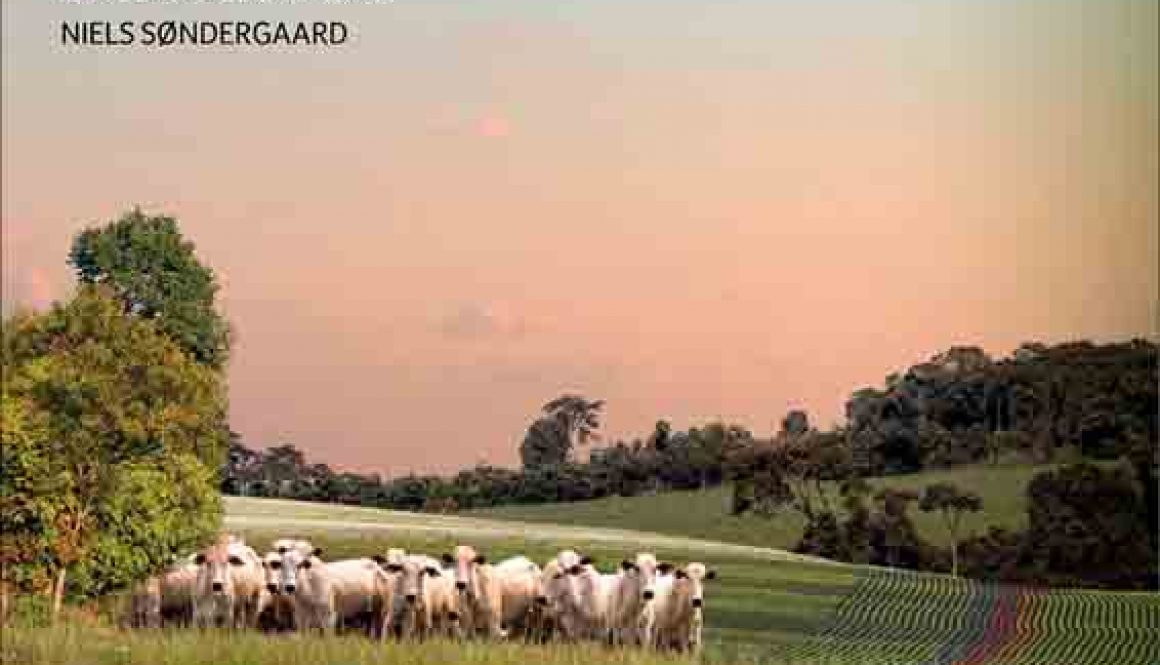
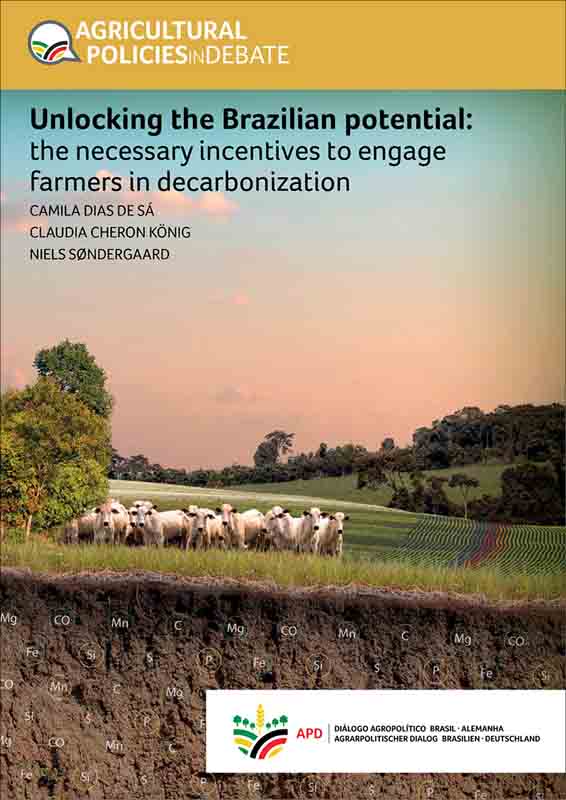 Der vorliegende englischsprachige Beitrag von Camila Dias de Sá und Claudia Cheron König, und Niels Søndergaard zeigt den aktuellen wissenschaftlichen Diskussionsstand zum Thema Carbon Farming und Carbon Markets.
Der vorliegende englischsprachige Beitrag von Camila Dias de Sá und Claudia Cheron König, und Niels Søndergaard zeigt den aktuellen wissenschaftlichen Diskussionsstand zum Thema Carbon Farming und Carbon Markets.